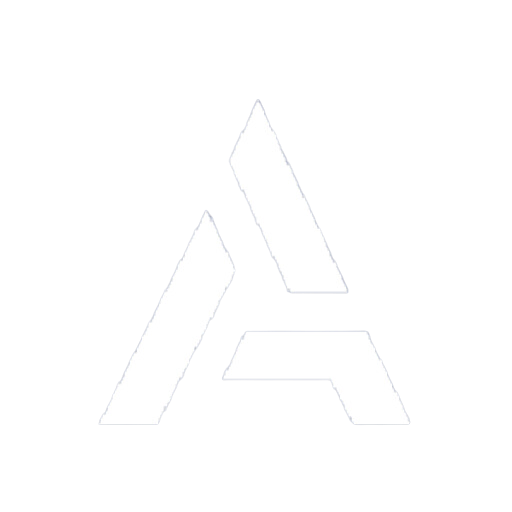Als wortwörtlich fundamentaler Teil eines jeden Gebäudes ist die Bodenplatte ein Thema, mit dem sich Bauherren unbedingt intensiv auseinandersetzen sollten. In diesem Ratgeber beleuchten wir die Vorteile und Nachteile des Hauses mit Bodenplatte, sprechen unter anderem über Planung, Materialien und Kosten und erklären, welche Arten von Bodenplatten in Deutschland üblich sind.
Was ist eine Bodenplatte?
Der Begriff Bodenplatte bezeichnet das Fundament von Häusern, das zwischen dem Erdreich der Baugrube und dem anschließenden Stockwerk platziert ist. Die Bodenplatte sorgt dafür, dass der Rest des Hauses auf einem stabilen Untergrund steht, trägt und verteilt das Eigengewicht des Bauwerks und ist zudem für den Ausgleich von Unebenheiten im darunterliegenden Erdboden verantwortlich.
Ist die Rede von einer tragenden Fundamentplatte, so handelt es sich bei dem zugehörigen Haus um eine Konstruktion ohne Keller. Im Gegensatz dazu sind Kellerbodenplatten nicht tragend. Weitere gängige Begriffe für die Bodenplatte sind im allgemeinen Sprachgebrauch Plattenfundament, Gründungsplatte und Plattengründung.
|
| Vorbereitung und Materialien: Bevor die Bodenplatte im Detail geplant wird, sollte ein Bodengutachten durchgeführt werden. Vor der Errichtung müssen wiederum die Erdarbeiten erledigt werden. Beim Bau von Bodenplatten kommen neben der Betonage Materialien für die Bewehrung (z.B. Stahlmatten), Dämmstoffe (z.B. Mineralfasern), Kies, Schotter oder Magerbeton für die Sauberkeitsschicht, Schalungsholz und Folien als Feuchtigkeitsbarriere zum Einsatz. |
| Fundamentarten: Wir unterscheiden ganzflächig abdeckende Plattenfundamente, punktuell eingesetzte Einzel- beziehungsweise Punktfundamente und Streifenfundamente, die unter den äußeren tragenden Wänden des Gebäudes verlaufen. |
| Kosten: Eine Bodenplatte kostet circa 74 bis 200 Euro pro Quadratmeter, wobei sich Fläche, Dicke, Dämmmaßnahmen, genutzte Materialien, Bodenplattenart, Bodenbeschaffenheit und das Preisniveau des Anbieters maßgeblich auf die konkreten Kosten auswirken. |
Vor- und Nachteile einer Bodenplatte
Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, möchten wir einen Überblick über die konkreten Vorteile und Nachteile der Bodenplatte geben:
Vorteile
- Geringe Kosten: Der Hausbau mit Bodenplatte und ohne Keller ist zumeist wesentlich günstiger
- Stabilität: Die Bodenplatte verleiht dem Haus seine Standsicherheit und reduziert den Einfluss von Eigenbewegungen im Erdreich auf das Gebäude
- Optimale Lastverteilung: Die Platte gewährleistet, dass das Gewicht des Hauses ideal über die Fläche des Fundaments verteilt wird
- Wärmeschutz und Energieeffizienz: Moderne Methoden der Dämmung ermöglichen einen hervorragenden Wärmeschutz, woraus Häuser mit hoher Energieeffizienz resultieren
- Schutz gegen Feuchtigkeit: Sperrschichten bieten auch bei einem erhöhten Grundwasserstand zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit
- Kurze Bauzeit: Im Vergleich zum Bau mit Keller nimmt die Fertigstellung einer Bodenplatte weniger Zeit in Anspruch
Nachteile
- Weniger Stau- und Nutzraum: Verzichtet man auf die Unterkellerung, entscheidet man sich auch gegen den zusätzlichen Stau- oder Nutzraum, den der Keller geboten hätte
- Aufwändige Wärmeschutzmaßnahmen: Da der Wohnraum beim Bauwerk ohne Keller direkt an die tragende Bodenplatte anschließt und somit unmittelbar über dem Baugrund liegt, sind vergleichsweise aufwändigere Wärmeschutzmaßnahmen zu treffen
Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, möchten wir einen Überblick über die konkreten Vorteile und Nachteile der Bodenplatte geben:
Planung und Vorbereitung
Beim Erstellen einer Bodenplatte sind Kenntnisse über die Bodenbeschaffenheit und die Grundwasserverhältnisse vor Ort unverzichtbar. Aus diesem Grund ist es ratsam, etwas Geld in ein Bodengutachten zu investieren. Der Gutachter ermittelt verschiedene Parameter, anhand derer sich die Platte optimal an den Boden angepasst planen lässt. Damit wird unter anderem verhindert, dass Risse in der Gründung entstehen oder Feuchtigkeit aus dem Erdreich die Stabilität des Gebäudes gefährdet.
Noch bevor mit dem Gießen der Bodenplatte begonnen werden kann, müssen einige Vorbereitungen in Form von Erdarbeiten getroffen werden. Je nach Gegebenheiten auf dem Grundstück und Eigenschaften des geplanten Baus muss zunächst eine Baugrube mit einer Tiefe von etwa 40 bis 100 Zentimetern ausgehoben werden. Der Boden wird im Anschluss begradigt und verdichtet, woraufhin die Verlegung von Abwasser- und Leerrohren vorgenommen werden kann. Das alles sind Schritte, die streng genommen noch nicht zum eigentlichen Bodenplattenbau gehören.
Materialien und Konstruktionstechniken der Bodenplatte
Da die Bodenplatte den Übergang zwischen Baugrund und Haus darstellt und sich somit maßgeblich auf die Statik und Energieeffizienz des Gebäudes auswirkt, spielt die Wahl geeigneter Materialien eine zentrale Rolle. Diese Materialien sind gängig:
- Kies, Sand, Schotter oder Magerbeton als Trenn- beziehungsweise Sauberkeitsschicht zwischen Erdboden und Bodenplatte
- PE- oder PVC-Folien als Feuchtigkeitsbarriere
- Dämmmaterial zwecks Wärmeschutz ober- und/oder unterhalb der Platte (z.B. Schaumglas, Polysterol-Schaum oder Mineralfaser)
- Bewehrungsstahl (z.B. Stahlmatten, -bügel oder -stäbe)
- Flüssigbeton
- Holz für die Schalung
Diese Schritte strukturieren den Aufbau der Bodenplatte:
Schritt 1: Verlegung der Sauberkeitsschicht (ggf. Einbringen von Streifenfundamenten)
An die vollständig abgeschlossenen Erdarbeiten schließt das Aufbringen der Sauberkeitsschicht aus Kies, Sand, Schotter oder Magerbeton mit einer Dicke von etwa fünf Zentimetern an. Gegebenenfalls erfolgt dann das Einbringen von Streifenfundamenten in circa 80 Zentimetern Tiefe. Diese werden unter den späteren tragenden Wänden des Gebäudes platziert und dienen mitunter dem Frostschutz (Frostschürze).
Schritt 2: Errichtung der Schalung
Es folgt der Aufbau der Schalung, die beim späteren Gießen der Bodenplatte als Rahmen fungiert.
Schritt 3: Anbringen der unteren Dämmung
Je nachdem, für welche Dämmungsart sich der Bauherr entschieden hat, erhält die Gründung schon zu diesem Zeitpunkt eine erste Dämmschicht. Schichten zur Dämmung unter der Fundamentplatte werden Untersohlendämmungen genannt.
Schritt 4: Auslegen der Folie
Zusätzlich wird der Übergang zwischen Boden und Bodenplatte mit einer Folie zum Schutz gegen Feuchtigkeit ausgestattet.
Schritt 5: Bewehrungsaufbau
Als nächstes steht die Ausführung der Arbeiten für die Bewehrung auf dem Plan. Beliebt sind hier Stahlmatten.
Schritt 7: Platzierung des Fundamenterders
Im Zuge des Aufbaus der Bewehrung wird auch der Fundamenterder in die Konstruktion integriert. Dabei handelt es sich um ein vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik vorgeschriebenes Teil, welches die Gründung erdet und das Haus für den Fall eines Blitzeinschlags absichert.
Schritt 8: Betonage
Dann gilt es, den Beton anzumischen und die Bodenplatte zu gießen. Der flüssige Beton wird mittels Pumpe gleichmäßig über dem bisherigen Aufbau verteilt, geebnet und verdichtet.
Schritt 9: Trocknen und Aufbringen der Estrich-Schicht
In Abhängigkeit der genauen Art von Beton und der Witterungsverhältnisse benötigt die Bodenplatte einen Zeitraum von mehreren Wochen, um vollständig durchzutrocknen. Zu guter Letzt wird eine Estrich-Schicht aufgebracht, die für einen schön glatten, gleichmäßigen Untergrund sorgt, auf dem weitere Dämmmaterialien sowie Bodenbeläge verlegt werden können.
Unter den Almondia Bautipps finden Sie übrigens ein Bautagebuch, das einen Hausbau von A bis Z dokumentiert und dabei selbstverständlich auch die Errichtung der Bodenplatte begleitet – eine spannende Lektüre für Bauherren und all jene, die vom Eigenheim träumen. Das folgende Video verrät Ihnen außerdem vier wertvolle Tipps zur Bodenplatten-Abnahme:
Fundament und die zugehörige Anwendung
Diese Fundament-Varianten können beim Hausbau zum Einsatz kommen:
- Streifenfundamente: Ein Streifenfundament verläuft entlang der äußeren Seite des Grundrisses. Es besteht aus Beton und schafft die Basis für die tragenden Hauswände beziehungsweise für die Kellerbodenplatte.
- Plattenfundamente: Der Begriff Plattenfundament bezeichnet die ganzflächige Bodenplatte. Anders als das Streifenfundament, bedecken Fundamentplatten die gesamte Grundrissfläche und sollen somit eine besonders gleichmäßige Verteilung der Objektlast gewährleisten.
- Punktfundamente (Einzelfundamente): Einzel- oder Punktfundamente werden für die Gründung tragender Stützen verwendet. Während sie beim klassischen Hausbau eher eine Ausnahme darstellen, kommen sie im Gewerbebau häufig zum Einsatz.
Dämmung und Abdichtung der Bodenplatte
Da eine Bodenplatte aus Beton alleine das Haus nur unzureichend vor Wärmeverlusten schützt, muss mithilfe einer durchdachten Dämmung dafür gesorgt werden, dass möglichst wenig Wärme ans Erdreich abgegeben wird. Die bereits kurz angesprochene Perimeterdämmung (Untersohlendämmung) unter der Bodenplatte ist hier der aktuelle Standard am Markt. Genutzt werden verschiedene Arten von Dämmschichten, allem voran Produkte aus Polysterol-Schaum und Mineralfasern. Über der Gründung dämmen Baufirmen in aller Regel mit Polyurethanschaum, Polysterol oder Schaumglas.
Bei besonders energieeffizienten Häusern wird außerdem gerne zu speziellen Thermobodenplatten gegriffen. Darauf, wie diese funktionieren und wie sie sich in Sachen Nachhaltigkeit auswirken, kommen wir später in diesem Artikel nochmals zu sprechen.
Neben der Dämmung ist beim Bau der Bodenplatte die Abdichtung von großer Bedeutung. Warum? Ganz einfach: Wird die Abdichtung vernachlässigt, kann Grundwasser aus dem Baugrund einsickern und die Substanz der Bodenplatte nachhaltig schädigen. Die Materialien zur Abdichtung haben die wichtige Aufgabe, genau das zuverlässig zu verhindern. Um das Bauwerk solide abzudichten, wird gerne Bitumen verwendet, aber auch Dichtungsbahnen aus Elastomeren und Kunststoffen bieten guten Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund.
Kostenaspekte
Der Preis einer Bodenplatte hängt von mehreren Faktoren ab und lässt sich folglich nicht pauschal beziffern. Zur ganz groben preislichen Einordnung ist ein Richtwert zwischen 75 Euro und 200 Euro pro Quadratmeter anzunehmen. Dabei beeinflussen diese Punkte die Kosten:
- Art und Ausführung: Ist ein Streifen-, Einzel- oder Plattenfundament geplant? Handelt es sich um eine tragende Bodenplatte oder um eine nicht-tragende Gründung für ein Haus mit Keller? Zusätzlich wirkt sich die Dicke der Bodenplatte auf den Preis aus.
- Fläche: Je größer die Fläche, für die die Bodenplatte als Basis dienen soll, desto teurer wird die Gründung.
- Baugrund: Der Arbeitsaufwand, der mit den Erdarbeiten und der Errichtung der Bodenplatte verbunden ist, hängt mitunter von den Boden- und Grundwasserverhältnissen vor Ort zusammen. Verhältnisse, die die Ausführung verschiedener Arbeiten erschweren oder spezielle Maßnahmen erforderlich machen, erhöhen den Preis.
- Materialien: Natürlich beeinflussen auch die gewählten Materialien (Beton für die Bodenplatte, Bewehrungs- und Schalungsmaterial, Material für die Sauberkeitsschicht etc.) die Gesamtkosten.
- Dämmung: Art und Umfang der Dämmmaßnahmen gehören ebenfalls zu den zentralen Kostenfaktoren.
- Anbieter: Anbieter von Bodenplatten gestalten die Kalkulation der Kosten teils unterschiedlich, weshalb es sich lohnt, Kostenvoranschläge einzuholen und Angebote zu vergleichen.
- Eigenleistung: Bauherren können die Kosten senken, indem sie einfache Arbeitsschritte rund um die Errichtung der Bodenplatte selbst ausführen.
Wenn Sie die Kosten für Ihr Bauprojekt realistisch abschätzen und sich einen Eindruck davon verschaffen möchten, wieviel Sie in Ihr Traumhaus investieren müssen, empfehlen wir Ihnen den Almondia Baukostenrechner. Im Anschluss an die Beantwortung einiger Fragen erwartet Sie hier eine kostenlose, unverbindliche Bauberatung inklusive passender Angebote.
Bauwesen: Bauvorschriften und rechtliche Aspekte
Bevor mit der Errichtung der Bodenplatte begonnen werden kann, muss selbstredend eine Baugenehmigung vorliegen. Beim Bau selbst ist auf die Einhaltung geltender Sicherheitsstandards – zum Beispiel die Verlegung eines Fundamenterders und die Erfüllung statischer Anforderungen – zu achten. Seriöse Baufirmen, die sich auf Keller und Bodenplatten spezialisiert haben, sind hier in aller Regel bestens informiert, sodass sich der Bauherr keine Sorgen um etwaige Missachtungen wichtiger Normen und Richtlinien machen muss.
Probleme und Lösungen
Wer ein Bodengutachten anfertigen lässt, sich mit den gängigen „Schwachstellen“ von Bodenplatten befasst und einen erfahrenen Anbieter beauftragt, hat gute Chancen, keinerlei Probleme mit seiner Bodenplatte zu haben – über viele Jahrzehnte hinweg. Dennoch möchten wir an dieser Stelle über einige häufig auftretende Problematiken und mögliche Lösungsansätze sprechen:
Problem #1: Fundamentsetzung
Viele im Bauwesen genutzte Materialien, wie etwa Holz und Beton, „arbeiten“ und befinden sich zwangsläufig in Bewegung. Das kann auch die Betonage der Bodenplatte betreffen. Dann verliert die Platte beispielsweise aufgrund klimatischer Veränderungen, einer nachgiebigen Sauberkeitsschicht, undichter Leitungen oder eines schwachen, lehmigen oder stark von Wurzeln durchzogenen Bodens unregelmäßig an Volumen. Letztere Ursachen können quasi ausgeschlossen werden, indem die Bodenplatte ideal an die im Bodengutachten ermittelten Parameter angepasst wird.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einer Setzung zu begegnen und deren weiteres Voranschreiten zu verhindern. So können zum Beispiel Expansionsharze zum Einsatz kommen, die die Widerstandsfähigkeit des Bodens verbessern.
Problem #2: Bildung von Rissen
Eines der wohl am weitesten verbreiteten Probleme mit Bodenplatten ist die Rissbildung, die ebenfalls oft auf Bodenbewegungen und eine ungünstige Bodenbeschaffenheit zurückgeht. Da aus kleinen Rissen schnell große Kerben werden, die die Stabilität des Hauses gefährden, Feuchtigkeit Tür und Tor öffnen und jede Menge Kosten verursachen können, sollten diese Mängel nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Eine abdichtende Reparatur ist zum Beispiel mit Epoxidharzmörtel möglich, vorbeugend sollte über die Integration von Dehnungsfugen in die Bodenplatte nachgedacht werden.
Problem #3: Feuchtigkeit
Wird in puncto Abdichtung unsauber gearbeitet, entwickelt sich aufsteigende Feuchtigkeit rasch zum Problem. Die Feuchtigkeit kann über die Bodenplatte in die Wände wandern und die Substanz des gesamten Gebäudes in Mitleidenschaft ziehen. Nachträglich kann auf Feuchtigkeitsprobleme mitunter mit der Verlegung von Bitumenbahnen und ähnlichen Dichtungsprodukten für Bodenplatten-Oberseiten reagiert werden.
Nachhaltigkeit und Umweltaspekte
Steht beim Bau eines Hauses die Energieeffizienz im Mittelpunkt, lohnt es sich, sich einmal genauer mit Thermobodenplatten zu beschäftigen. Diese sind mit einer Flächenheizung versehen, die in mehrere Schichten Dämmmaterial eingebettet ist. Eine solche Bodenplatte verursacht beim Bau deutlich höhere Kosten, verbessert aber die Energiebilanz des Gebäudes und beschert dem Besitzer dadurch langfristig Einsparungen bei den Heizkosten. Außerdem kann auf einen Heizestrich verzichtet werden und das Risiko für Feuchtigkeitsprobleme wird minimiert. Ganz zu schweigen davon, dass eine Thermoplatte eine nachhaltige, umweltfreundliche Wahl ist.
Fazit
Die Bodenplatte ist das Fundament, auf dem das gesamte Gebäude ruht, und spielt eine entscheidende Rolle für die Stabilität, Energieeffizienz und Langlebigkeit des Hauses. Sie stellt eine kostengünstige Alternative zum Keller dar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung hinsichtlich Bodenbeschaffenheit, Dämmung und Abdichtung. Hochwertige Materialien wie Glapor Schaumglas verbessern die Wärmedämmung, während ein präziser Rundschliff oder eine Glatthaar-Oberfläche für eine ebene Basis sorgen. Wer Wert auf modernes Design legt, kann sich für eine Glasbodenplatte entscheiden, während eine Biohort Technikbox eine praktische Stauraum-Alternative zum Keller bietet.
Eine gut durchdachte Bodenplatte ist die Basis für ein langlebiges und energieeffizientes Zuhause.
FAQs
Wie findet man einen guten Anbieter für Bodenplatten?
Wir raten dazu, sich einen Überblick über die verfügbaren Anbieter in der Region zu verschaffen, Angebote zu vergleichen und auch die Erfahrungen anderer Bauherren in die Entscheidung miteinzubeziehen. Sollten Sie Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Anbietern für Ihren Hausbau benötigen, sind Sie bei Almondia definitiv an der richtigen Adresse. Wir versorgen Sie nicht nur mit reichlich Infomaterial, sondern stellen auch eine auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmte Vorschlagsliste mit seriösen, bewährten Anbietern für Sie zusammen.
Welche Stärke sollte eine Bodenplatte haben?
Die optimale Stärke einer Bodenplatte hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von den Bauwerkslasten, der Grundfläche und der Bodenbeschaffenheit. Üblicherweise liegt die Dicke zwischen 20 und 40 cm, wobei eine verstärkte Stahlbeton-Bodenplatte bei schweren Bauwerkslasten oder großen Spannweiten erforderlich sein kann. Spezielle Varianten wie die Glasbodenplatte oder die Glatthaar-Bodenplatte haben oft abweichende Anforderungen.
Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei der Bodenplatte?
Die Wärmedämmung ist essenziell, um Wärmeverluste ins Erdreich zu minimieren und die Tragfähigkeit der Bodenplatte nicht zu beeinträchtigen. Hochwertige Dämmsysteme wie Glapor Schaumglasplatten bieten eine nachhaltige Lösung, da sie sowohl isolieren als auch lastverteilend wirken. Alternativ kann eine Betonplatte mit Rundschliff für eine besonders glatte Oberfläche und bessere Dämmung sorgen. Die Wahl der richtigen Dämmtechnik hängt von der geplanten Grundfläche und den energetischen Anforderungen des Gebäudes ab.
Wie wirkt sich die Größe der Bodenplatte auf die Kosten pro Quadratmeter aus?
Die Größe der Bodenplatte ist einer der wichtigsten Kostenfaktoren. Generell gilt: Je größer die Fläche in Quadratmeter, desto günstiger wird der Preis pro Quadratmeter, da sich Fixkosten auf eine größere Fläche verteilen. Allerdings beeinflussen auch Faktoren wie die Bodenbeschaffenheit, die Art der Stahlbeton-Verstärkung und spezielle Wünsche wie eine Glasbodenplatte oder eine zusätzliche Wärmedämmung die endgültigen Kosten. Manche Bauherren setzen auf Lösungen wie eine Biohort-Technikbox als Alternative zu einer teuren Unterkellerung.
Welche Vorteile bietet eine Glasbodenplatte im Vergleich zur klassischen Glatthaar-Bodenplatte?
Eine Glasbodenplatte sorgt für Lichtdurchlässigkeit und modernes Design, während eine Glatthaar-Bodenplatte eine besonders geglättete Betonoberfläche bietet. In Kombination mit Glapor Schaumglas als Dämmung kann die Energieeffizienz verbessert werden. Ein Rundschliff sorgt für eine noch glattere Oberfläche. Wer zusätzlichen Stauraum benötigt, kann alternativ eine Biohort Technikbox als Lösung in Betracht ziehen.